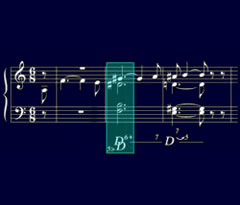Venedig Liebeskrank und Geburt der musikalischen Moderne Wagner verließ die spannungsgeladene Konstellation des Züricher „Asyls“ am 17. August 1858. Als Ort seines nächsten Exils wählte er (auf Anraten seines Freundes Karl Ritter) Venedig, da er hoffte, „als politischer Flüchtling, in Venedig, welches, obschon zu Österreich, dennoch nicht zum Deutschen Bunde gehörte, nichts zu befürchten“ (ML) zu haben – ein Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte.
Am 29. August 1858 traf Wagner in Venedig ein und verbrachte die erste Nacht im Hotel Danieli. Am folgenden Tag quartierten sich Wagner und sein Begleiter Karl Ritter im Palazzo Giustinian am Canal Grande neben dem Ca' Foscari ein. Die etwas heruntergekommene Wohnung ließ Wagner nach seinem Geschmack umgestalten, dazu gehörten vergoldete Möbel, rote Tapeten und Teppiche, aber auch sein geliebter Erard-Flügel, den er sich zusammen mit seinem Bett von Zürich nach Venedig bringen ließ. Hier vollendete Wagner den zweiten Akt des „Tristan“. Wagner fühlte sich in Venedig einsam, häufig war er krank. Er schrieb lange Briefe und führte ein für Mathilde Wesendonck bestimmtes Tagebuch. In „Mein Leben“ beschrieb er seinen Tagesablauf: „Ich arbeitete bis zwei Uhr, bestieg dann die bereitgehaltene Gondel, um den ernsten Canale Grande entlang nach der heiteren Piazzetta zu fahren, deren ungemein reiche Anmut jeden Tag von neuem belebend auf mich einwirkte. Dort suchte ich mein Restaurant auf dem Markusplatze auf, promenierte nach der Mahlzeit einsam oder mit Karl die Riva entlang nach dem Giardino pubblico, der einzigen mit Bäumen bepflanzten Anlage Venedigs, um dann mit dem Einbruche der Nacht auf der Gondel wieder in den immer ernster und schweigender sich anlassenden Kanal hinabzufahren, bis dahin, wo ich aus der nächtlichen Fassade des alten Palazzo Giustiniani einzig meine Lampe mir entgegenleuchten sah. Wenn ich dann einiges noch gearbeitet hatte, traf regelmäßig um acht Uhr, vom Plätschern der Gondel angemeldet, Karl bei mir ein, um beim Tee einige Stunden mit mir zu verplaudern.“ Wagner verließ Venedig nur selten, gelegentlich machte er Ausflüge nach dem Lido und besichtigte Galerien und Kirchen. Die Venezianischen Theater besuchte Wagner nicht häufig, die italienische Oper lehnte er wegen der „großen Demoralisierung des italienischen Kunstgeschmacks“ (ML) ab. „Nur selten unterbrach ich diese Lebensweise durch den Besuch eines der Theater, von welchen ich dem Schauspiel im Theater Camploi [1894 abgerissen], wo Goldonische Stücke sehr gut aufgeführt wurden, den entschiedenen Vorzug gab, wogegen der Oper nur aus Neugierde eine vorübergehende Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Am häufigsten, namentlich wenn schlechtes Wetter an der Promenade hinderte, besuchten wir das am Tage sich produzierende Volksschauspiel im Theater Malibran]; dort, wo der Eintritt sechs Kreuzer betrug, befanden wir uns unter einem vortrefflichen Publikum (meistens in Hemdärmeln), welchem am häufigsten Ritterstücke vorgespielt wurden. Doch sah ich hier auch eines Tages zu meinem wahrhaften Erstaunen und völligen Entzücken das groteske Lustspiel »Le baruffe Chiozziote«, welches bereits Goethe am gleichen Orte zu seiner Zeit so sehr angesprochen hatte und welches mit einer Naturtreue gegeben wurde, wie ich dem nichts Ähnliches aus meiner Erfahrung zur Seite stellen kann.“ (ML)
Am Markusplatz wurden laut Wagner häufig in öffentlichen Konzerten auch Teile seiner eigenen Kompositionen gespielt: „Die Kapellmeister der beiden in Venedig kantonierten österreichischen Regimenter gingen damit um, Ouvertüren von mir, wie die zu »Rienzi« und »Tannhäuser«, spielen zu lassen, und ersuchten mich darum, in ihren Kasernen den Einübungen ihrer Leute beizuwohnen. […] Ihre Musikbanden spielten abwechselnd des Abends bei glänzender Beleuchtung in Mitte des Markusplatzes, welcher für diese Art von Musikproduktionen einen wirklich vorzüglich akustischen Raum abgab.“ Bei dieser Gelegenheit wurde sich Wagner aber auch der politischen Spannung bewusst, die in Venedig unter der habsburgischen Herrschaft bestand: „zu Tausenden scharte man sich um die Musik und hörte ihr mit großer Spannung zu; nie aber vergaßen sich zwei Hände so weit, zu applaudieren, weil jedes Zeichen des Beifalls an einer österreichischen Militärmusik als ein Verrat am Vaterlande gegolten haben würde. – An dieser sonderbaren Spannung zwischen Publikum und Behörde litt nun eben alles öffentliche Leben in Venedig, und namentlich äußerte sich dies auffallend in dem Verhalten der Bevölkerung gegen die österreichischen Offiziere, welche in der venezianischen Öffentlichkeit wie Öl auf dem Wasser herumschwammen.“ Auch Wagner selbst wurde schließlich Opfer dieser Spannung: „In Venedig, das damals von Österreich verwaltet wurde, galt Wagner als steckbrieflich gesuchter Revolutionär. Also wurde er observiert und als sich die Auseinandersetzungen zwischen den italienischen Patrioten des Risorgimento, die für ein unabhängiges und einiges Italien eintraten, und der österreichischen Besatzung militärisch zuzuspitzen begannen, erhielt er am 1. Februar 1859 einen Ausweisungsbefehl. Zwar konnte er Aufschub bewirken und so den zweiten Aufzug des „Tristan“ noch beenden, aber dann musste er abreisen, denn die Österreicher zogen nun gegen die italienische Freiheitsbewegung Truppen zusammen, und Wagner wollte vermeiden, in die sich abzeichnenden militärischen Auseinandersetzungen zu geraten.“ (UB) In Folge kehrte Wagner zurück in die Schweiz. |